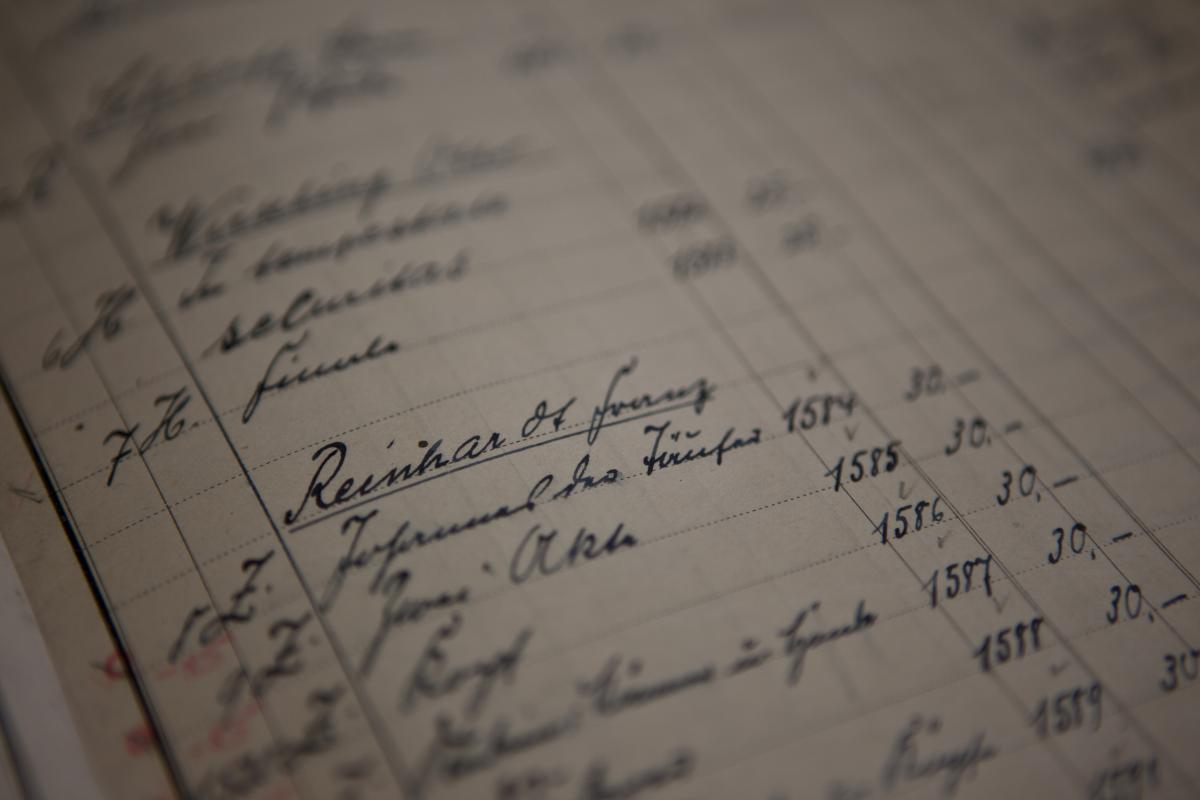Meldungen
Kontakt
NS-Raubgut
Koloniale Kontexte
Kriegsverluste
SBZ / DDR
NS-Raubgut
Koloniale Kontexte
SBZ / DDR


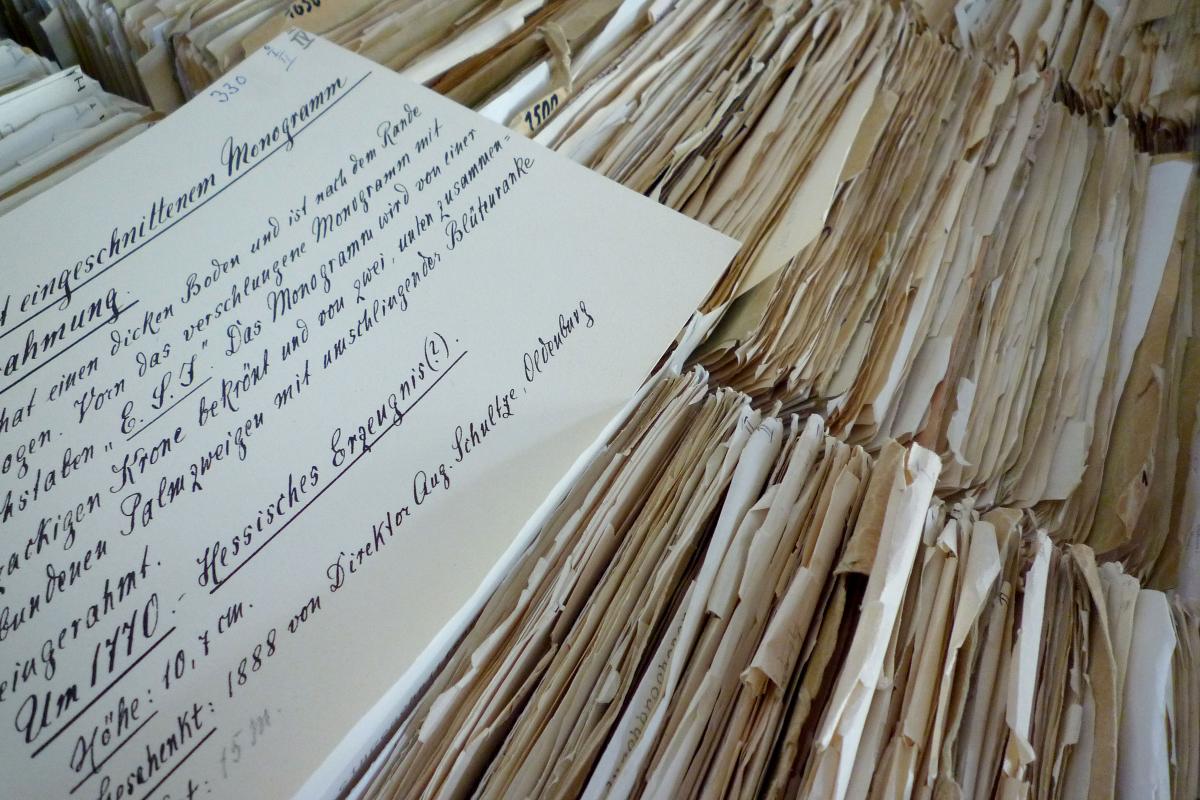


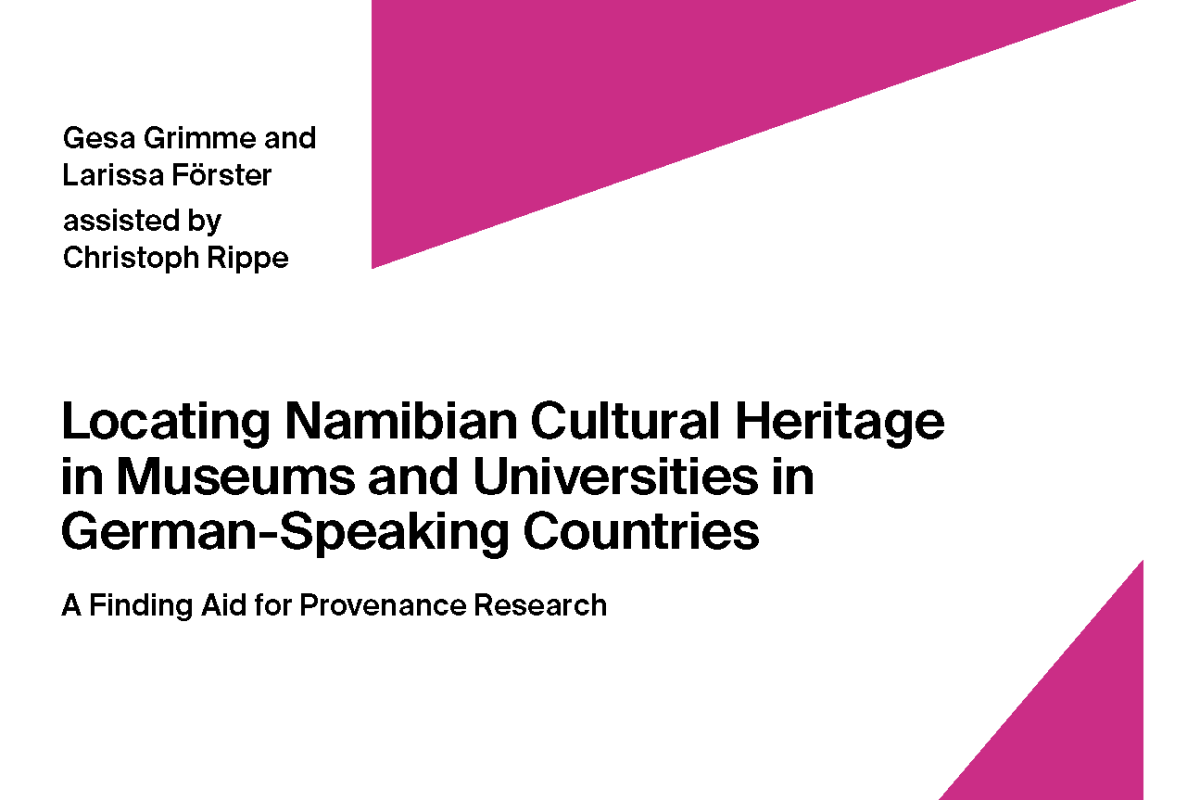


![Plakat der Sonderausstellung „Herkunft [un]geklärt“, Johann Peter Melchior / Manufaktur Höchst, Ganymed, um 1770, Porzellan / Provenienzmerkmale. Plakat der Sonderausstellung „Herkunft [un]geklärt“](/sites/default/files/styles/3_2/public/2024-03/2024-03_Leitmotiv_Herkunft_%5Bun%5Dgekl%C3%A4rt_FINAL.jpg?h=d2cb3bc7&itok=_BrBHmAc)